
|
|
Abkürzung für "Accelerated Graphics Port" • Nach ISA, EISA,
Microchannel, LocalBus und PCI kommt jetzt ein weiterer Steckplatz / Bus ins Spiel - der
AGP. Er die Grafik schneller und realistischer.
Die Idee ist simpel: Man erlaube der Grafikkarte, sich nach Belieben Speicherplatz vom Arbeitsspeicher (RAM) auf der Hauptplatine abzuzweigen, und
sorge mit einem unabhängigen, separaten Grafikbus dafür, daß die Daten auf direktem
Wege schnell herbeigeschafft werden können. Damit sollen 3D-Animationen deutlich
realistischer werden, als dies heute möglich ist. Die neue Technik hat aber einen
Pferdefuß: um in ihren Genuß zu kommen, sind auf jeden Fall ein neues Motherboard und
eine AGP-Grafikkarte nötig. Da Programme bislang nicht von solch üppigem Grafikspeicher
ausgehen konnten, wird für künftigen Augenschmaus auch neue Software nötig sein. Und
schließlich bedarf es noch der Unterstützung durch das Betriebssystem, die Microsoft
erst für WINDOWS 98 und Windows NT 5 verspricht.
Der AGP-Bus wird mit 66 Megahertz getaktet; gegenüber dem mit 33 Megahertz getakteten
PCI bedeutet dies eine Erhöhung der maximalen Übertragungsrate auf 266 Megabyte pro
Sekunde (MB/s). Im Pipelining-Verfahren des 2x-Modus (siehe den Kasten) kommt man sogar auf einen Maximalwert
von 595 MB/s, was der vierfachen Geschwindigkeit des PCI-Busses entspricht. Die höhere
Bandbreite beim Datentransfer ist nicht der einzige Vorteil, den AGP gegenüber PCI zu
bieten hat.
- So verfügt AGP beispielsweise über einige zusätzliche Signalleitungen, um das
Pipelining zu steuern. Während beim PCI-Bus eine Anforderung von Daten erst dann erfolgen
kann, wenn der vorangegangene Datentransfer abgeschlossen ist, können beim AGP Daten
bereits angefordert werden, während die zuvor verlangten Daten noch im Speicher gesucht
werden.
- Am AGP-Bus hängt ausschließlich die Grafik. So kann die gesamte Bandbreite des Busses
genutzt werden, ohne auf andere Geräte (SCSI-Adapter, ISDN-Karte,...) Rücksicht nehmen
zu müssen. Damit ist AGP aber nicht so universell wie der PCI-Bus, für den es alle
möglichen Steckkarten gibt. Der AGP wird eher als Erweiterung, denn als Ersatz für PCI
gesehen.
- Texturen können direkt aus dem Arbeitsspeicher (RAM) ausgeführt werden.
- Auf der AGP-Grafikkarte reichen 4 Megabyte RAM auch für anspruchsvolle Aufgaben aus.
- Hauptprozessor (CPU) und Grafikchip können quasi gleichzeitig auf das RAM zugreifen.
- Auf die Grafikdaten im RAM kann die CPU schneller zugreifen als auf den lokalen
Grafikspeicher auf der Karte.
AGP ist nicht gleich AGP. In den
Spezifikationen sind verschiedene Modi definiert, mit denen unterschiedlich große
Bandbreiten erreicht werden. Für die erreichbare Geschwindigkeit des Grafik-Subsystems
ist diese Bandbreite ganz entscheidend.
- AGP 1x: Allein der auf 66 Megahertz verdoppelte Bustakt liefert mit 266 MB/s einen
doppelt so hohen Datendurchsatz wie PCI. Zu beachten ist dabei, daß es sich bei dieser
Angabe - wie bei allen hier dargestellten Modi - um einen Peak handelt. Die in der Praxis
erreichten Werte liegen darunter.
- AGP 2x: Hier wird nicht nur die aufsteigende, sondern auch die abfallende Flanke des
66-MHz-Clock-Signals dazu benutzt, einen Datentransport zu initiieren. Das Resultat: eine
maximale Übertragungsrate von 528 MB/s.
Ob der schnellere 2fach-Modus unterstützt wird, hängt vom Hersteller der Grafikkarte ab.
Es muß damit gerechnet werden, daß vor allem bei Billigkarten nur 1x geboten wird.
Außerdem: In der Praxis kann 2x nicht doppelt so schnell sein wie 1x, da 528 MB/s bereits
die maximale Bandbreite des Arbeitsspeichers ist, auf den aber auch die CPU zugreift.
- AGP 4x: Den Engpaß beim Speicherzugriff könnte der 4x-Modus beseitigen. Voraussetzung
dafür ist eine Erhöhung des AGP-Bustakts von 66 auf 100 Megahertz. Damit wird rein
rechnerisch ein Peak von 800 MB/s erreicht. Motherboards für den 100-MHz-Takt werden erst
1998 erwartet. Sie benötigen als Chipsatz den INTEL 440 BX (Pentium II) oder den VIA
Apollo VP4 (Pentium), die noch in der Entwicklung sind. Mit zusätzlichem Demultiplexing
von Adressen und Daten werden im 4x-Modus Datentransfers mit Geschwindigkeiten bis zu 1
GB/s erwartet.
- AGP 10x: Der große Sprung auf 10x war für Ende 1999 angekündigt.
|
|
![]()
AGP - "Accelerated Graphics Port"
AMR
CNR
EISA - "Extended Industry Standard Architecture"
ISA - "Industrie Standard Architecture"
Local Bus
MCA - "Micro Channel Architecture"
PCI-Bus - "Peripheral Component Interconnect Bus"
PCI-X
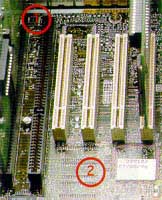
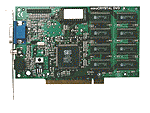 Abgelöst wurde der ISA-Bus 1991
nach einigen weniger erfolgreichen Zwischenlösungen (
Abgelöst wurde der ISA-Bus 1991
nach einigen weniger erfolgreichen Zwischenlösungen (