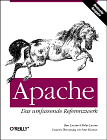Webspace-Urteil: Ohrfeige für Serien-Abmahner
(Meldung von heise online vom
23.1.2000)
In einem Urteil vom Dezember 1999 hat die Kammer für Wettbewerbs-Sachen am
Landgericht München I eine Klage des "Webspace"-Markeninhabers Klaus Thielker
(vertreten durch Anwalt Günter Frhr.
v. Gravenreuth) gegen den minderjährigen Betreiber der Website www.web4space.de (vertreten durch
seinen Vater) auf Zahlung von 1108,80 DM Abmahngebühren abgewiesen. Die Abmahnung hatte
wie in etlichen ähnlichen Fällen die Benutzung des geschützten Markenbegriffs
"Webspace" auf einer Homepage zum Gegenstand. In diesem Fall erklärte der
Abgemahnte schriftlich, er werde die Benutzung des fraglichen Begriffs künftig
unterlassen – nur die geltend gemachten Kosten wollte er nicht übernehmen. Daraufhin
klagte Thielker.
Verblüffend dürfte vielen Beobachtern der einschlägigen Rechtsprechung die
Begründung des Urteils erscheinen: Da es sich um eine "Serienabmahnung zum
alleinigen Zweck des Geldverdienens" handle, sei der Kläger nicht berechtigt, den
Beklagten zur Erstattung der Kosten heranzuziehen – so das Gericht. Vielmehr sei die
Durchsetzung eines vermeintlichen Erstattungsanspruchs auf dem Klagewege hier sogar als
Rechtsmißbrauch anzusehen. Weil seine Klage abgewiesen wurde, muss Thielker nun auch die
Kosten des Gerichtsverfahrens selbst tragen.
Dabei haben die Richter die Frage, ob die konkrete Abmahnung begründet ist und der
Abgemahnte sich tatsächlich einer Markenverletzung schuldig gemacht hat, gar nicht erst
beantwortet. Völlig außen vor blieb die Frage um die Schutzfähigkeit der Marke
"Webspace", für die beim deutschen Patent- und Markenamt zur Zeit ein
Löschungsverfahren anhängig ist. Maßgeblich ist für die Münchner Richter, dass die
Abmahnung nach ihrer Auffassung nicht dem Interesse des Abgemahnten, sondern nur dem Zweck
einer Gebührenforderung gegolten hat.
Normalerweise dient eine Abmahnung dazu, dem Betroffenen eine gerichtliche
Auseinandersetzung zu ersparen. Insofern läßt die Rechtsprechung dafür im Allgemeinen
den Grundsatz der "Geschäftsführung ohne Auftrag" gelten und gesteht dem
Abmahnenden das Recht zu, sich die Gebühren für das anwaltliche Schreiben vom
Abgemahnten erstatten zu lassen. Das gilt jedoch nicht, so das Münchner Gericht, wenn es
sich um einen serienweise durchgeführten Vorgang handelt, der die konkreten individuellen
Umstände des Abgemahnten gar nicht berücksichtigt und so auch nicht in dessen Interesse
liegen kann.
Im vorliegenden Fall hat es seit August 1999 14 gleichartige Abmahnungen an Website-Betreiber
gegeben. In der Urteilsbegründung vermerkt das Gericht sogar, Thielker habe seinen
Markennamen praktisch nur im Zusammenhang mit diesen Aktionen konkret genutzt. Er ist
dann, wie den Richtern beim Studium eines anderen
"Webspace"-Urteils auffiel, sogar gegen solche Homepagebesitzer vorgegangen, die
den bewußten Begriff nur als "allgemeine Inhaltsangabe" in einer Kopfzeile
benutzten. Thielker habe selbst dort noch geklagt, "wo jeder vernünftige und
halbwegs an einem fairen Verfahren Interessierte" darauf verzichte,
Gerichtsentscheidungen zu "erzwingen". Damit habe er, so die Urteilsbegründung,
sein "Kosteninteresse" besonders deutlich dokumentiert.
Der Kardinalfehler des "Webspace"-Markengladiators Gravenreuth dürfte darin
gelegen haben, dass er den Ausführungen des Beklagten, es gehe um eine Serienabmahnung zu
Profitzwecken, und die ganze Marke diene ihrem Inhaber nur dazu, Anderen ihre Benutzung zu
verbieten, in seinen Schriftsätzen noch nicht einmal widersprach. Daher hatte das Gericht
es leicht, diese Aussage als unbestritten zu übernehmen. Die umfangreichen Ausführungen
Gravenreuths zur markenrechtlichen Lage der Sache waren dann ohne Belang.
Das Urteil dürfte nicht nur für Thielker und Gravenreuth eine schallende Ohrfeige
bedeuten, sondern für alle Serienabmahner, die auf der lukrativen Gebührenwelle reiten.
Es bleibt abzuwarten, ob andere Gerichte sich in ähnlich gelagerten Fällen der
Rechtsauffassung des Münchner Landgerichts anschließen und damit dem gerade in den
letzten Monaten stark gewachsenen Abmahnunwesen in Markenrechtsdingen den Boden entziehen.
|
Autoresponder
Domain
HTML
LINUX
Mailinglisten
PHP
Server / Web-Server
SQL-Datenbanken
World Wide Web (WWW, 3W, Web)
kommentierte Beispiele von Web-Seiten