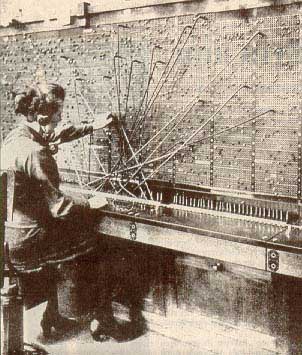http://www.glossar.de/glossar/z_telefon.htm
Der Siegeszug des Telefons und seiner Ableger (Fax, Modem, ISDN-Karte, ...) ist auch 120 Jahre nach der Erfindung des "Fernsprechens" längst noch nicht abgeschlossen. Das frühere Einheitstelefon ist einer unübersehbaren Gerätepalette und vielfachen Anwendungsmöglichkeiten gewichen - und Vielfalt gibt es ab dem 1. Januar 1998 auch bei den Anbietern. Mit dem Fall des Monopols der Telekom sind die Zeiten der "Fernsprechordnung" endgültig vorbei.
Ganz anders erlebte die heutige Großelterngeneration das Phänomen Telefon. Damals fristete der schlichte Kasten an der Dielenwand ein relativ unbeachtetes Dasein. Ein Ferngespräch wurde oft lange im voraus geplant und sorgfältig auf seine Notwendigkeit hin überprüft. Das Telefonieren empfand man als Ausnahmesituation, die es schnell wieder zu beenden galt. Obwohl für Ortsgespräche noch kein Zeittakt existierte, beschränkte sich der Anrufende meist auf die reine Mitteilung. Zur Darstellung der seelischen Befindlichkeit schien der "Fernsprecher", wie er damals amtlich hieß, ungeeignet. Zum Kommunikationszentrum avancierte die Diele gelegentlich, wenn der telefonlose Nachbar den Arzt rufen mußte oder die Verwandten kurzfristig ihren Besuch absagten.
Bereits 1854 regte der französische Erfinder Charles Bourseul an, mit
Schwingungen, die durch das Sprechen auf eine biegsame Scheibe oder eine Membran
entstehen, einen elektrischen Schaltkreis zu schließen und wieder zu öffnen und auf eine
ebenfalls mit einer Membran versehene Apparatur zu übertragen. Sieben Jahre später
gelang dies dem deutschen Physiker Johann Philip Reis: Er baute den ersten Apparat, der
die menschliche Sprache elektrisch übertragen konnte. Am 26. Oktober 1861 hielt Philipp
Reis im Frankfurter Senckenberg-
Mit welch "primitiven" Mitteln Reis damals arbeitete, mag die Schwimmblase eines
großen Störs zeigen, die ihm als Membran diente. Auf ihr hatte er ein Platinstück
befestigt, das selbst wieder federnd auf einem Metallstreifen ruhte. Je nach
Schwingungszustand der Membran kam es zur intermittierenden (wechselnden, pulsierenden)
Berührung der beiden Metallteile und damit zum Fließen oder zur Unterbrechung des
Stromes. Sprache konnte damit aber nur dann verständlich übertragen werden, wenn die
Einstellung des Apparates exakt so war, daß keine Unterbrechungen eintraten, sondern der
Berührungsdruck den Stromfluß gleichsam "modulierte". Nur so konnten
wellenförmige Ströme entstehen, die Schallwellen reproduzierten. Dem Lehrer für Chemie
und Physik gelang es in den Folgejahren nicht, seine Erfindung wesentlich
weiterzuentwickeln. Er starb nahezu vergessen 1874 an Tuberkulose.
Seit Mitte der 70er Jahre des 19. Jahrhunderts experimentierte dann
Alexander Graham Bell an einem ähnlichen Projekt, wobei bis heute das Maß der Anlehnung
an Reis umstritten ist. Bell, 1847 in Edinburgh (Schottland) geboren, war zunächst nach
Kanada ausgewandert. Später lebte er in Boston (USA). Nach einer Reihe von Mißerfolgen
präsentierte der ehemalige Taubstummenlehrer dem Publikum seine verbesserte
Versuchsanordnung. Bell verließ sich auf die Induktionsgesetze: bei ihm wird ein
Stückchen Metall, das er auf seine Mikrofon-
Viel Detailarbeit hatte den Durchbruch gebracht. Am 14. Februar 1876 läßt Bell seine
Erfindung patentieren. Genau zwei Stunden nach Bell meldet sich in gleicher Sache ein
anderer Amerikaner beim Patentamt: Elisha Gray. Zu spät, um am Erfinderruhm teilzuhaben.
Doch Bell sollte über seine Erfindung zunächst nicht recht froh werden. In mehreren
Prozessen mußte er sich des Vorwurfs erwehren, die Reissche Entwicklungen an sich
gerissen zu haben, doch entschieden die US-
Weitere Telefonpioniere waren dann David Edward Hughes, Thomas Alva Edison,
Generalpostmeister Stephan und Werner von Siemens. Erst das Kohlemikrophon von Hughes
machte das Telefon wirklich gebrauchsfähig.